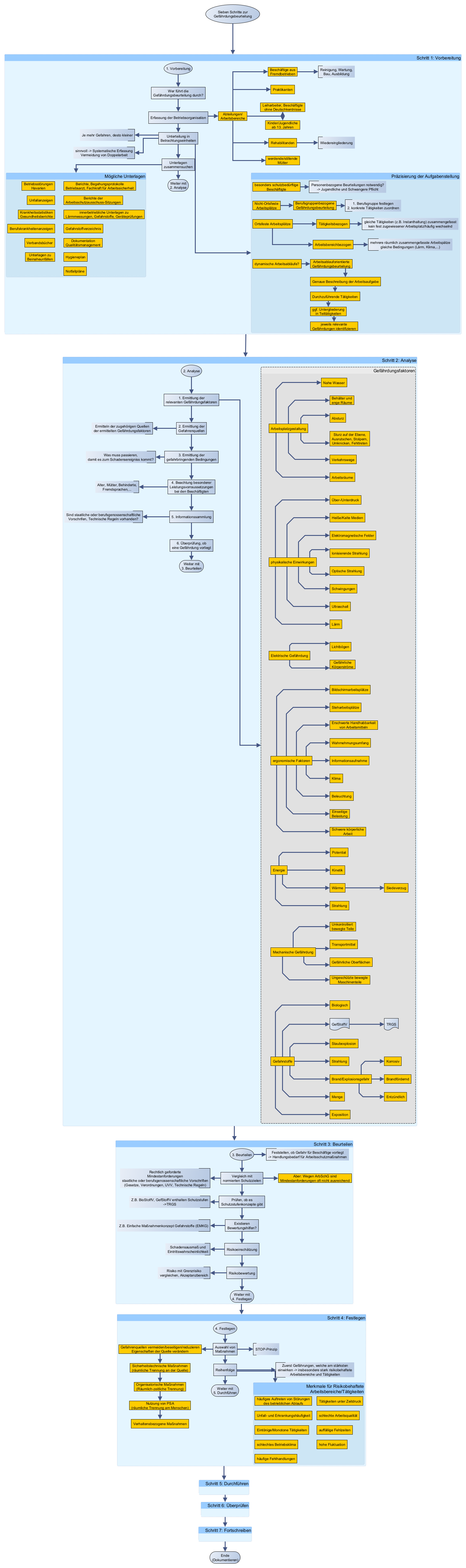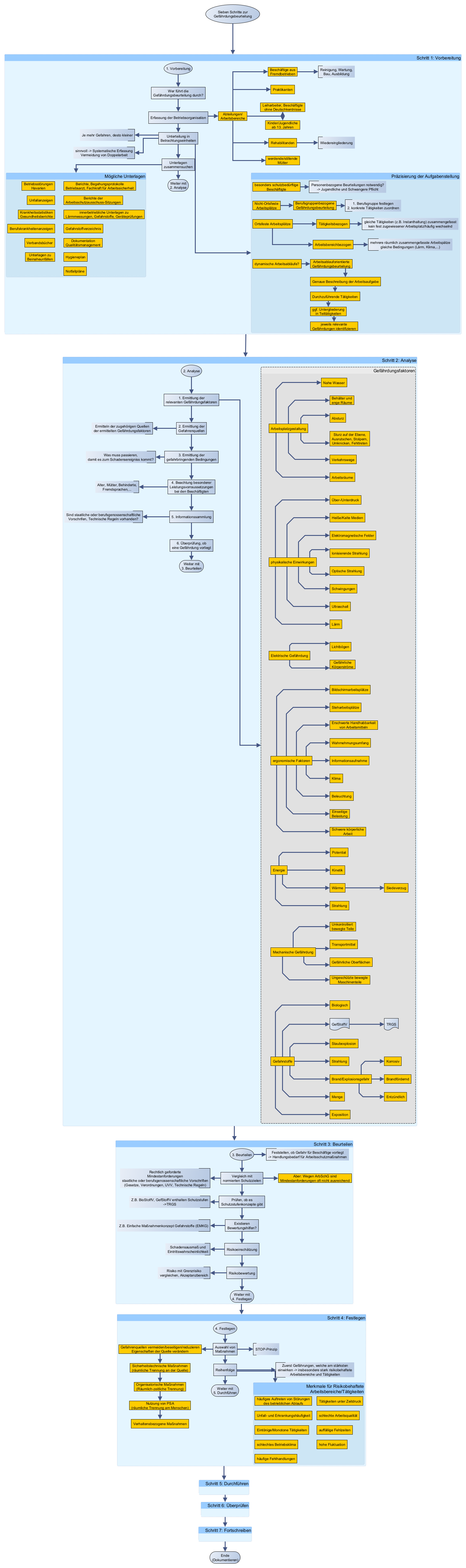Schritt 1: Vorbereitung
1. Vorbereitung
Wer führt die
Gefährdungsbeurteilung durch?
Erfassung der Betriebsorganisation
Abteilungen/
Arbeitsbereiche
Kinder/Jugendliche
ab 13. Jahren
werdende/stillende
Mütter
Rehabilitanden
Wiedereingliederung
Leiharbeiter, Beschäftigte
ohne Deutschkentnisse
Praktikanten
Beschäftige aus
Fremdbetrieben
Reinigung, Wartung,
Bau, Ausbildung
Unterteilung in
Betrachtungseinheiten
Je mehr Gefahren, desto kleiner
sinnvoll -> Systematische Erfassung
Vermeidung von Doppelarbeit
Präzisierung der Aufgabenstellung
Ortsfeste Arbeitsplätze
Nicht-Ortsfeste
Arbeitsplätze
besonders schutzbedürftige
Beschäftigte
Personenbezogene Beurteilungen notwendig?
-> Jugendliche und Schwangere Pflicht
dynamische Arbeitsabläufe?
Arbeitsbereichbezogen
Tätigkeitsbezogen
mehrere räumlich zusammengefasste Arbeitspätze
gleiche Bedingungen (Lärm, Klima,...)
gleiche Tätigkeiten (z.B. Instanthaltung) zusammengefasst
kein fest zugewiesener Arbeitsplatz/häufig wechselnd
1. Berufsgruppe festlegen
2. konkrete Tätigkeiten zuordnen
Berufsgruppenbezogene
Gefährdungsbeurteilung
Arbeitsablauforientierte
Gefährdungsbeurteilung
Genaue Beschreibung der Arbeitsaufgabe
Durchzuführende Tätigkeiten
ggf. Untergliederung
in Teiltätigkeiten
jeweils relevante
Gefährdungen identifizieren
Unterlagen
zusammensuchen
Mögliche Unterlagen
Berichte, Begehungsprotokolle
Betriebsarzt, Fachkraft für Arbeitssicherheit
Berichte der
Arbeitsschutzausschuss-Sitzungen
innerbetriebliche Unterlagen zu
Lärmmessungen, Gefahrstoffe, Geräteprüfungen
Gefahrstoffverzeichnis
Dokumentation
Qualitätsmanagement
Hygieneplan
Notfallpläne
Betriebsstörungen
Havarien
Unfallanzeigen
Krankheitsstatistiken
Gesundheitsberichte
Berufskrankheitenanzeigen
Verbandsbücher
Unterlagen zu
Beinaheunfällen
Weiter mit
2. Analyse
Schritt 2: Analyse
2. Analyse
1. Ermittlung der
relevanten Gefährdungsfaktoren
Gefährdungsfaktoren
Energie
Strahlung
Wärme
Kinetik
Potential
Gefahrstoffe
Staubexplosion
Exposition
Menge
Brand/Explosionsgefahr
Strahlung
GefStoffV
TRGS
Biologisch
Arbeitsplatzgestaltung
Arbeitsräume
Verkehrswege
Sturz auf der Ebene,
Ausrutschen, Stolpern,
Umknicken, Fehltreten
Absturz
Behälter und
enge Räume
Nahe Wasser
ergonomische Faktoren
Schwere körperliche
Arbeit
Einseitige
Belastung
Beleuchtung
Klima
Informationsaufnahme
Wahrnehmungsumfang
Erschwerte Handhabbarkeit
von Arbeitsmitteln
Steharbeitsplätze
Bildschirmarbeitsplätze
Mechanische Gefährdung
Ungeschützte bewegte
Maschinenteile
Gefährliche Oberflächen
Transportmittel
Unkontrolliert
bewegte Teile
Elektrische Gefährdung
Gefährliche
Körperströme
Lichtbögen
Siedeverzug
Korrosiv
Brandfördernd
Entzündlich
physikalische Einwirkungen
Lärm
Ultraschall
Schwingungen
Optische Strahlung
Ionisierende Strahlung
Elektromagnetische Felder
Heiße/Kalte Medien
Über-/Unterdruck
2. Ermittlung der
Gefahrenquellen
Ermitteln der zugehörigen Quellen
der ermittelten Gefährdungsfaktoren
3. Ermittlung der
gefahrbringenden Bedingungen
4. Beachtung besonderer
Leistungsvorraussetzungen
bei den Beschäftigten
5. Informationssammlung
6. Überprüfung, ob
eine Gefährdung vorliegt
Sind staatliche oder berufsgenossenschaftliche
Vorschrifen, Technische Regeln vorhanden?
Was muss passieren,
damit es zum Schadensereigniss kommt?
Alter, Mütter, Behinderte,
Fremdsprachen,...
Weiter mit
3. Beurteilen
Schritt 3: Beurteilen
3. Beurteilen
Weiter mit
4. Festlegen
Feststellen, ob Gefahr für Beschäftige vorliegt
-> Handlungsbedarf für Arbeitsschutzmaßnahmen
Vergleich mit
normierten Schutzzielen
Rechtlich geforderte
Mindestanforderungen
staatliche oder berufsgenossenschaftliche Vorschriften
(Gesetze, Verordnungen, UVV, Technische Regeln)
Aber: Wegen ArbSchG sind
Mindestanforderungen oft nicht ausreichend
Prüfen, ob es
Schutzstufenkonzepte gibt
Z.B. BioStoffV, GefStoffV enthalten Schutzstufen
->TRGS
Existieren
Bewertungshilfen?
Z.B. Einfache Maßnahmenkonzept Gefahrstoffe (EMKG)
Risikoeinschätzung
Risikobewertung
Schadensausmaß und
Eintrittswahrscheinlichkeit
Risiko mit Grenzrisiko
vergleichen, Akzeptanzbereich
Schritt 4: Festlegen
4. Festlegen
Weiter mit
5. Durchführen
Gefahrenquellen vermeiden/beseitigen/reduzieren
Eigenschaften der Quelle verändern
Sicherheitstechnische Maßnahmen
(räumliche Trennung an der Quelle)
Organisatorische Maßnahmen
(Räumlich-zeitliche Trennung)
Nutzung von PSA
(räumliche Trennung am Menschen)
Verhaltensbezogene Maßnahmen
Auswahl von
Maßnahmen
STOP-Prinzip
Reihenfolge
Merkmale für Risikobehaftete
Arbeitsbereiche/Tätigkeiten
häufiges Auftreten von Störungen
des betrieblichen Ablaufs
auffällige Fehlzeiten
Unfall- und Erkrankungshäufigkeit
häufige Fehlhandlungen
Eintönige/Monotone Tätigkeiten
Tätigkeiten unter Zeitdruck
schlechtes Betriebsklima
hohe Fluktuation
schlechte Arbeitsqualität
Zuerst Gefährungen, welche am stärksten
einwirken -> insbesondere stark risikobehaftete
Arbeitsbereiche und Tätigkeiten
Schritt 5: Durchführen
Schritt 6: Überprüfen
Schritt 7: Fortschreiben
Sieben Schritte zur
Gefährdungsbeurteilung
Ende
(Dokumentieren)